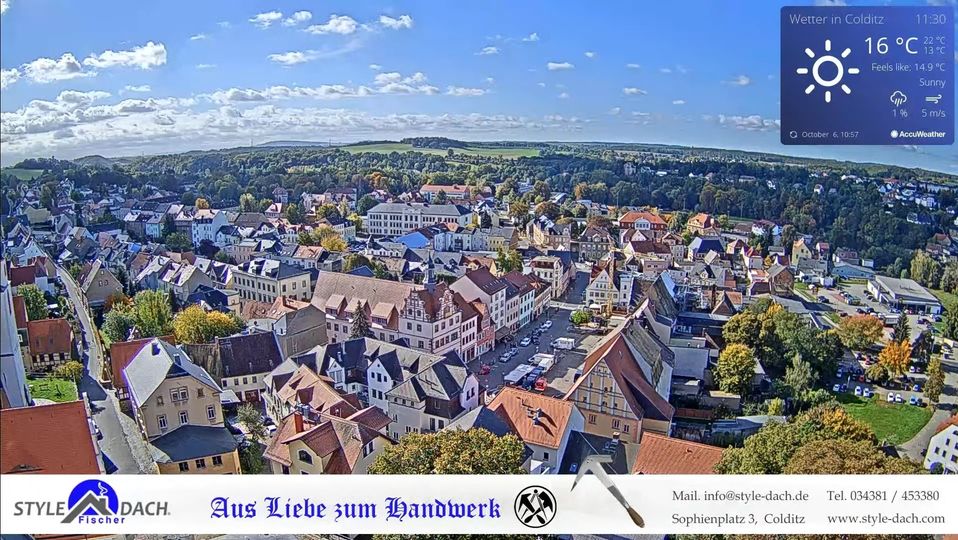Rechter Schieferhammer von Freund
Sächsische Art und Form

Dieser schöne Schieferhammer ist nicht leicht zu bekommen. Wir von Style Dach besorgen dir aber das Teil denn wir haben die Kontakte! Wir arbeiten sehr viel damit und es ist etwas Besonderes diesen tollen Hammer zu besitzen.
Jetzt sächsischen Schieferhammer kaufen

Im Style Dach Shop auch verfügbar
Klick hier: Sächsischer Schieferhammer
Die Geschichte des Schieferhammers
Der Schieferhammer ist weit mehr als nur ein Hammer; er ist das vielseitigste und wichtigste Werkzeug in der Hand des Schieferdeckers. Seine spezielle Form kombiniert Hammer, Beil und Locher in einem, um die filigrane und anspruchsvolle Arbeit der Schieferdeckung zu ermöglichen.
Seit wann gibt es den Schieferhammer?
Die Kunst der Schieferdeckung hat eine lange Tradition, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Die spezielle Form des Schieferhammers, wie wir ihn heute kennen – mit der charakteristischen, scharfen Schneide und dem Dorn –, entwickelte sich jedoch parallel zur Verbreitung der regional unterschiedlichen Decktechniken, etwa ab dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit.
Die Notwendigkeit eines spezialisierten Werkzeugs ergab sich aus der Beschaffenheit des Materials. Schiefer muss auf Maß behauen, für die Nagelbefestigung gelocht und in die Deckung gebracht werden. Mit der Blüte des Schieferabbaus und der Etablierung regionaler Dachdeckerzünfte, insbesondere in den Schieferregionen Deutschlands und Frankreichs, wurden die unterschiedlichen Hammerformen perfektioniert.
Welche Arten von Schieferhämmern gibt es?
Diese Frage wird häufig auf Google gestellt, und die Antwort liegt in den regionalen Decktechniken. Die drei bekanntesten und am weitesten verbreiteten Arten sind der Sächsische, der Rheinländische und der Französische Schieferhammer. Ihre Unterschiede sind subtil, aber entscheidend für das jeweilige Handwerk.
Der Sächsische Schieferhammer
Herkunft: Erzgebirge und die Regionen der Naturschiefer-Verwendung in Ostdeutschland.
Charakteristik: Er ist oft schlanker und leichter als der Rheinländische Hammer.
Hammerkopf: Relativ klein und präzise.
Schneide (Beil): Die scharfe Klinge ist meist gerade oder nur leicht konvex geformt. Sie dient zum Zurechthauen der Schieferplatten.
Dorn (Locher): Der Dorn zum Lochen der Platten ist oft dünner und sehr spitz, was sich aus den sächsischen Deckarten (wie der altdeutschen Deckung) ergibt, die kleinere Schieferstücke verwenden.
Einsatz: Bevorzugt für die Altdeutsche Deckung und die Schuppendeckung, welche eine sehr genaue Bearbeitung der einzelnen Pliefer erfordern.

Der Rheinländische Schieferhammer
Herkunft: Die Schieferabbaugebiete im Rheinischen Schiefergebirge, wie beispielsweise die Regionen um Mayen.
Charakteristik: Er ist tendenziell kräftiger und robuster gebaut, was seine Vielseitigkeit unterstreicht.
Hammerkopf: Oft größer und schwerer, was mehr Schlagkraft beim Nageln ermöglicht.
Schneide (Beil): Die Klinge ist im Vergleich zum sächsischen Hammer deutlich konvex (gebogen) geformt. Diese Rundung erleichtert das Behauen der Schieferplatten für die Bogenschnittdeckung und andere Deckarten, die runde Formen verlangen.
Dorn (Locher): Der Dorn ist oft etwas massiver und dient zum Einschlagen der Nagellöcher.
Einsatz: Er ist der „Allrounder“ und wird oft für die Deutsche Deckung und die klassische Rechteckdeckung eingesetzt.
Der Französische Schieferhammer
Herkunft: Schiefergebiete Frankreichs, zum Beispiel Anjou.
Charakteristik: Der französische Hammer unterscheidet sich optisch am stärksten.
Hammerkopf: Ähnlich dem rheinländischen Hammer.
Schneide (Beil): Die Klinge ist in der Regel sehr kurz und extrem gebogen (sichelförmig). Diese Form ist ideal, um die in Frankreich oft verwendeten rechteckigen Platten schnell und präzise zu bearbeiten.
Dorn (Locher): Anstatt eines runden Dorns besitzen viele französische Hämmer eine feine Spitze oder einen kleinen Meißel zum Anreißen und Lochen.
Einsatz: Ideal für die französische Rechteckdeckung (Pose en Cloué), die in geraden Reihen verlegt wird.
Wofür benutzt man einen Schieferhammer genau?
Der Schieferhammer ist das Schweizer Taschenmesser des Dachdeckers und erfüllt drei elementare Funktionen:
Hauen/Zuschneiden: Die scharfe, beilartige Klinge dient dazu, Schieferplatten schnell und präzise auf die benötigte Form und Größe zu bringen. Dies geschieht in Kombination mit der sogenannten Haubrücke oder dem Haueisen.
Lochen: Mit dem spitzen Dorn werden die Nagellöcher in die Schieferplatte gestanzt, an der Stelle, wo sie später auf die Dachlatte genagelt wird.
Nageln: Der eigentliche Hammerkopf dient dazu, die Schiefernägel sicher in das Holz einzutreiben, ohne die Platte zu beschädigen.
Tipp für Handwerker: Die Wahl des Hammers richtet sich in erster Linie nach der Region und der dort üblichen Decktechnik. Wer hauptsächlich altdeutsche Deckung ausführt, wird mit dem sächsischen Hammer besser zurechtkommen. Wer flexibel sein muss, greift oft zum Rheinländer.